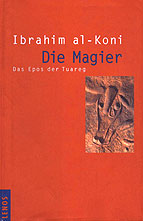|
Nichts
weniger als ein Epos zu schreiben, das die Erinnerung an dieses Volk und
seine Lebensform bewahrt, hat Ibrahim al-Koni sich mit den Magiern vorgenommen.
Zentrales Thema darin ist wohl am ehesten das Verhältnis der unterschiedlichen
Vorstellungen von Wâw zueinander, jenem Traumort, der sich in zahlreichen
Werken al-Konis wiederfindet. Dabei spielen die wirklich existierenden
Orte dieses Namens eine eher untergeordnete Rolle. Wichtig für das
Denken der Menschen ist das grosse Wâw, das Paradies, aus dem der
Urahn vertrieben wurde und in das zurückzukehren sich alle sehnen.
Inzwischen aber muss man sich mit dem kleineren Wâw zufrieden geben:
dem Ort der Rettung für Irrende, für solche, die, vom Wege abgekommen,
am Rande des Todes stehen, jener Stadt, die zu einem kommt, die nicht
durch Suchen auffindbar ist. Deshalb auch muss Anâj scheitern, den
seine Hybris dazu verleitet, dieses Wâw selbst errichten, den Traum
in die Wirklichkeit umsetzen zu wollen. Daneben gibt es immer noch andere,
divergierende Vorstellungen von Wâw, beispielsweise diejenige, es
handle sich nur um einen Männervorwand, um sich der wahren Bindung
zu entziehen, oder diejenige, es sei nichts ausserhalb des Menschen Vorhandenes,
sondern nur in seiner Brust zu finden.
Vor diesem Hintergrund von Wâw-Vorstellungen spielt sich eine doppelte
Geschichte ab. Da ist einerseits die Auseinandersetzung zwischen sesshaft
und nomadisch, zwischen der neu entstehenden Stadt und dem Lager, das
eigentlich schon zu lange an dieser Stelle steht und so eine Neigung zur
Sesshaftigkeit offenbart. Zu dieser Auseinandersetzung gehören auch
der Kampf ums Wasser, dem wirklichen "Gold der Wüste",
und dem Streit um den Handel mit Gold, dem verruchten Metall, vor dessen
Gebrauch der Prophet Muhammad gewarnt hat und dessen Besitz sich die Dschinnen
vorbehalten haben. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung spielt sich eine
Liebesgeschichte mit einem fast "klassisch" zu nennenden Dreiecksmuster
ab: Ocha liebt Tênere, die Udâd liebt, der Ocha (aus anderem,
schon älterem Grund) grollt. Die Liebesgeschichte endet tragisch:
Tênere und Udâd, deren Begegnung den Roman eröffnet,
gehen aus unterschiedlichen Gründen an ihrer Liebe zugrunde.
Stoff genug für einen Roman, den Ibrahim al-Koni jedoch auch als
Epos verstanden wissen will, in dem er, unter Einarbeitung zahlreicher
Einzelmythen aus dem Mittelmeer- und dem Sahararaum, einen grossen Mythos
zu schaffen sich vorgenommen hat. "Der Roman ist der Mythos der modernen
Zeit, der Mythos ist der Roman der alten Zeit", so liest man in einem
seiner Aphorismen, so definiert er für sich selbst die Gattung seines
Werkes, gedacht sozusagen als Verbindung der beiden.
(aus
dem Nachwort des Übersetzers)
Leseprobe
(PDF)
|
|